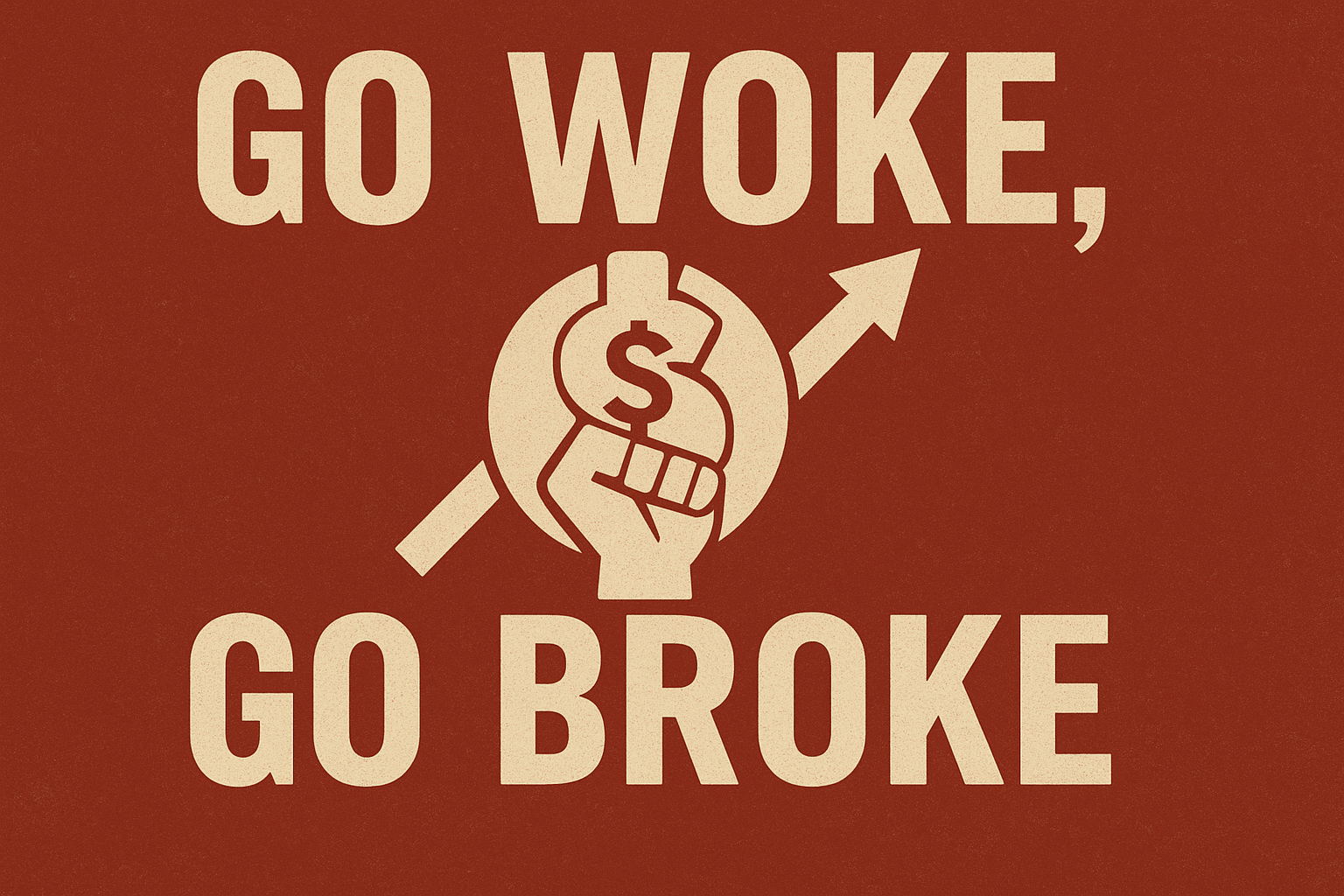
Die Wirtschaft soll Gewinn erwirtschaften, Marken sollen begeistern und Produkte sollen gekauft werden – so einfach war einmal die Formel für unternehmerischen Erfolg. Doch seit einigen Jahren mischt sich ein neuer Faktor in die Entscheidungsfindung großer Konzerne: die „woke economy“. Was ursprünglich aus dem akademischen und politischen Raum kam – der Anspruch, gesellschaftliche Missstände durch bewusste Sprache, Bilder und Unternehmenspolitik zu korrigieren – hat inzwischen in vielen Marketingabteilungen, Designstudios und sogar Vorstandsetagen Fuß gefasst. Das Problem: Dort, wo Wokeness nicht von Kunden gefordert, sondern von oben verordnet wird, kann sie fatale wirtschaftliche Folgen haben.
Vor allem in der Werbebranche und in kleinen, aber einflussreichen Teilen des gehobenen Managements börsennotierter Unternehmen hat sich eine enge Verflechtung mit „liberalen“ und dezidiert „woken“ Politikströmungen etabliert. Entscheidungen, die eigentlich am Kundengeschmack, an Marktanalysen und Gewinnpotenzialen ausgerichtet sein sollten, werden zunehmend entlang ideologischer Linien getroffen – und entfernen sich oft weit von den Wünschen und Bedürfnissen der tatsächlichen Käufer.
Fall 1: Lamborghini und das Gender-Dilemma
Luxus, Leistung, Exklusivität – dafür steht Lamborghini. Wer einen SUV mit 800 oder gar 900 PS als Zweit-, Dritt- oder Viertwagen kauft, ist in einer sehr spezifischen Zielgruppe zu Hause: kaufkräftig, markenbewusst, leistungsorientiert. Doch statt diese Klientel mit der gewohnten Mischung aus Prestige und Überlegenheit anzusprechen, veröffentlichte Lamborghini jüngst einen Pressetext, der bis ins Detail durchgegendert war. Politisch korrekt vielleicht – marken- und zielgruppenadäquat eher nicht. Dass diese Sprachwahl die Käufergruppe für Luxusautos im sechsstelligen Preissegment emotional erreicht, darf bezweifelt werden.
Fall 2: Anheuser-Busch InBev und das „Bud Light“-Debakel
2023 ging der weltweit größte Bierbrauer ein PR-Risiko ein, das sich als Bumerang erwies: Die Trans-Influencerin Dylan Mulvaney, eine Ikone der US-Liberalen, wurde mit einem Instagram-Video als Werbegesicht für „Bud Light“ präsentiert. Der Versuch, das Bier „diverser“ und „progressiver“ zu positionieren, scheiterte krachend. Die Kernzielgruppe – überwiegend konservativ geprägte Biertrinker im mittleren Amerika – reagierte mit einem massiven Boykott. Die Verkaufszahlen brachen ein, das Image erlitt schweren Schaden.
Fall 3: Harley-Davidson und die Abkehr vom eigenen Mythos
Harley-Davidson ist mehr als ein Motorradhersteller – es ist ein Lebensgefühl. Jahrzehntelang war der großvolumige Zweizylinder-V-Motor mit seinem unverwechselbaren Sound das Herzstück der Marke. Doch ein neues Management erklärte diese Tradition kurzerhand zur überholten Technologie und setzte voll auf Elektromobilität. Für hunderttausende loyale Harley-Fahrer weltweit kam dies einem Verrat gleich. Die Community reagierte mit Ablehnung, viele wandten sich ab – und einige fanden bei Konkurrenten wie „Indian“ eine neue Heimat. Das Ergebnis: sinkende Verkaufszahlen, verunsicherte Händler und eine Unternehmensführung, die nun leise über eine Kurskorrektur nachdenkt.
Fall 4: Jaguar und die Entfremdung vom Markenkern
Auch bei Jaguar setzte man auf radikale Neuausrichtung: ein neues Logo, eine rein elektrische Modellpalette und ein Design, das mit der traditionellen Jaguar-Ästhetik kaum noch etwas gemein hat. Selbst der Marketingversuch, den Stil eines „James Bond“-Gentleman mit der Marke zu verknüpfen, wirkte bemüht – zumal Bond in keinem Film je einen Jaguar fuhr. Die Reaktion der weltweiten Jaguar-Gemeinde: Entsetzen und Zurückhaltung bei Bestellungen. Der verantwortliche CEO ist inzwischen Geschichte, das Unternehmen sucht einen Weg zurück – ohne das Gesicht zu verlieren.
Diese vier Fälle stützen den vielzitierten Satz: „Go woke, go broke.“ Wenn Unternehmen Ideologie über Marktwissen stellen, riskieren sie den Bruch mit ihrer Kernkundschaft – und oft auch den finanziellen Absturz.
Das Gegenbeispiel: American Eagle und die Unerschütterlichkeit des Marktes
Doch es gibt auch die umgekehrte Geschichte. Die US-Modekette „American Eagle“ brachte einen Spot mit Schauspielerin Sidney Sweeney heraus. Der Slogan „Sidney Sweeney has great jeans.“ war kein Wortspiel – doch Teile der links-woken Szene behaupteten, es hieße eigentlich „genes“ (Gene) und sei ein versteckter rassistischer Kommentar. Was folgte, war der übliche Shitstorm: Boykottaufrufe, moralische Empörung, Social-Media-Entrüstung. Das Ergebnis? Die Verkaufszahlen schossen nach oben, die Aktie legte deutlich zu. Der Versuch, den Sturm zu inszenieren, scheiterte an der Realität des Marktes: Die Kunden kauften unbeeindruckt – oder gerade wegen der Empörung.
Fazit: Kunden wollen keine Erziehung
Die Lehre aus diesen Beispielen ist eindeutig: Der Markt folgt nicht der Ideologie, sondern dem Bedürfnis. Konsumenten wollen keine moralische Nachhilfe, keine sprachpolitischen Experimente und keine erzwungene Werteerziehung, wenn sie ein Produkt kaufen. Sie erwarten Qualität, Identität und Authentizität – und sie merken sehr genau, wenn eine Marke plötzlich versucht, ihnen ein fremdes Image aufzuzwingen.
In einer Zeit, in der viele Unternehmen verzweifelt um Kundenbindung ringen, ist das Festhalten an Markenkern und Zielgruppenverständnis wichtiger denn je. Wokeness mag in bestimmten Nischen funktionieren – im Massenmarkt jedoch gilt: Wer am Kunden vorbeiarbeitet, arbeitet am eigenen Untergang.
Titel-/Vorschaubild: KI
Eine Werbeabteilung, die ohne umfangreiche Meinungsumfragen bei Kunden bzw. potentiellen Kunden, das Markenimage – heute Corporate identity genannt, ändert, gehört sofort ausgetauscht. Ideologie hat in der freien Marktwirtschaft nichts verloren. Die Ideologie-PR-Dilettanten werden sicherlich mit offenen Armen bei NGOs und allen Organisationen mit Gehirnwäschefaktor aufgenommen werden, denn Propaganda, Manipulation, Umerziehung sind dort gefragt. Vielleicht nötigt man ja wieder eine alteingesessene „Mohren-Apotheke“ zu politisch korrekter Namensänderung oder man braucht Souffleure bei einem TV-Termin des 16.000.- Euro „Mastas Mundl“, wie so treffend „der Wegscheider“ immer satirisch kommentiert. Steuergeld gibt’s immer – auch ohne Leistung. In der Wirtschaft allerdings zählt der Erfolg, darum werden Versager dort auch nicht lange überleben.