
Informationen zum geplanten Mercosur-Abkommen
Über drei Jahre ist es her, daß ein Abkommen der EU mit der südamerikanischen Wirtschaftsorganisation MERCOSUR am österreichischen Veto scheiterte. Nach drei Jahren und kaum nennenswerten Veränderungen, geschweige denn Verbesserungen des Vertragsvorschlags, will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen es wieder versuchen.
Die Idee dieses Abkommens ist mit wenigen Worten auf den Punkt gebracht: Die MERCOSUR-Staaten sollen ohne Beschränkungen landwirtschaftliche Güter auf dem EU-Markt vertreiben können und die EU-Staaten sollen zollfrei Produkte aus der Industrie nach Südamerika liefern können. So weit so einfach. Daß diese Idee über kurz oder lang eine Konkurrenz im Lohnkostenbereich mit sich bringt, wird gänzlich übersehen.

Zu MERCOSUR:
Die Vollmitglieder sind Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay und Venezuela. Venezuela ist auf Grund seiner politischen und Menschenrechts-Situation seit 2016 suspendiert. Dazu kommen noch die assoziierten Mitglieder: Bolivien, Chile, Peru, Kolumbien, Ecuador, Suriname und Guyana. Im Grunde ist der gesamte Kontinent, abgesehen vom französischen Überseeterritorium Französische Guyana MERCOSUR-Land.
Zielsetzung dieses Bundes war – und so beginnen alle guten (und schlechten) Wirtschaftsstories – die Intensivierung der Zusammenarbeit zur Förderung von Forschung, Verbesserung der technologischen Basis und Stärkung des Außenhandels. Binnenzölle sind abgeschafft und die MERCOSUR-Staaten haben auch ein gemeinsames Design des Reisepasses. All das ähnelt ein wenig der EU. Allerdings gibt es doch erhebliche Unterschiede. Scheinbar beobachten die Damen und Herren in Südamerika die europäische Union sehr genau und vermeiden dann die EU-Fehler. Denn eine gemeinsame Währung gibt es nicht. Und bislang gibt es auch keine irgendwie ernst gemeinten Bestrebungen, ein Währungs-Konstrukt zu errichten, das zwangsläufig durch die verschieden ausgerichteten Volkswirtschaften zum Scheitern verurteilt ist.
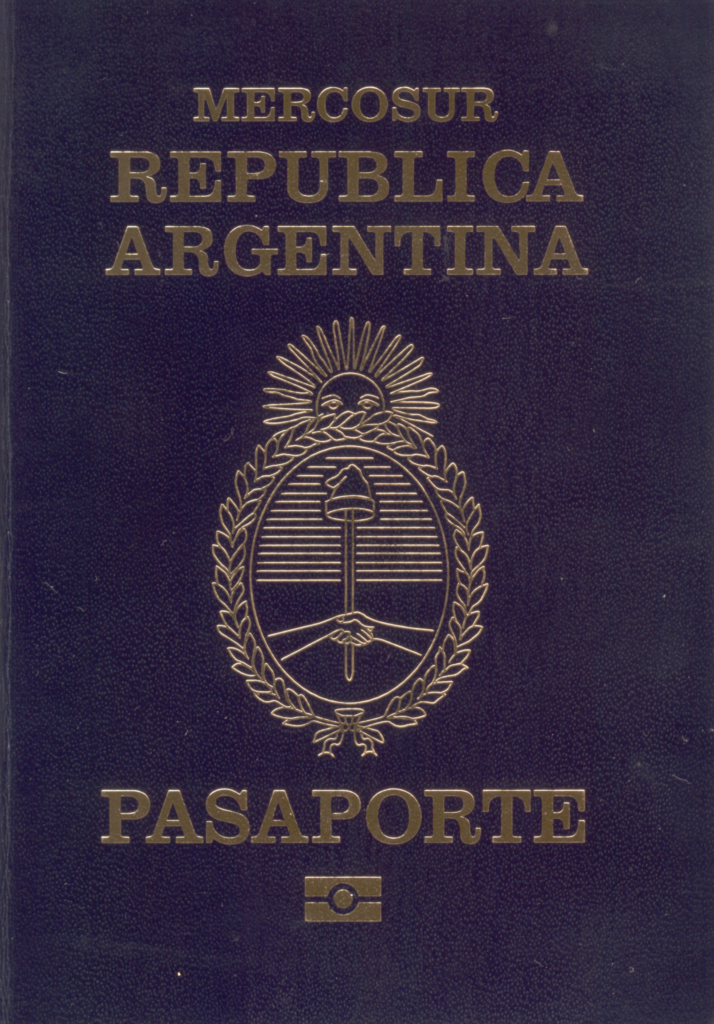
Ein weiterer Punkt zur Betrachtung von Mercosur ist seine Lage: Die USA sehen diesen Tausende Kilometer entfernten Staat als „Vorgarten der USA“. Jede gemeinsame Aktion und Entscheidung muß auch immer darauf ausgelegt sein, die rasch beleidigten USA nicht zu reizen. Die fehlende gemeinsame Strategie für den Umgang mit den USA sind natürlich auch der Konfliktstoff, an dem man sich intern abarbeitet.
Mit der EU hatte man über lange Jahre ein Abkommen zusammengeschustert, das für beide Beteiligten so halbwegs erträglich zu sein schien. Allerdings scheiterte es – wie erwähnt – am österreichischen Veto, das noch unter Schwarz-Blau beschlossen wurde, aber erst unter Schwarz-Grün schlagend wurde. Die Giftzähne für die heimische Agrarwirtschaft waren zu wenig gezogen worden. Über drei Jahre später macht man sich allerdings auf, das gleiche Abkommen wieder zur Entscheidung zu bringen. Keine Änderungen. Die Führungsetage der EU agiert wie ein trotziges Kind und will einfach so lange lästig sein, bis man nachgibt.
Wo liegen die Gefahren für die heimische Landwirtschaft oder Industrie? Die Landwirtschaft befürchtet nicht zu Unrecht, mit erheblich günstiger produzierten Agrarprodukten aus Südamerika vom Markt gedrängt zu werden. Teilweise sicherlich richtig. Allerdings ist die Angst, daß sich nun halb Europa nur noch von Steaks argentinischer Rindviecher ernährt, gänzlich übertrieben. Gefährlicher sind schon die dann im Raum stehenden Lieferungen bspw. an Soja oder anderen Feldprodukten, die in Südamerika – sobald es der Markt hergibt – in utopisch anmutenden Flächen angebaut werden. Und wenn 1000 mal Regeln für nachhaltige Produktion und Umweltschutz in das Abkommen hineinverhandelt werden, muß man auch soweit Realist sein, um einzusehen, daß Südamerika groß, die Auslegung solcher Umweltschutzregeln großzügig, die staatlichen Kontrollorgane stets fern vom Geschehen, und schlußendlich die Menschen in Südamerika zu arm sind, um sich um solche Orchideen-Vorgaben zu kümmern.
In schier unbeschreiblicher Selbstüberschätzung meint man in der EU, daß man einen so großen technologischen Vorsprung hätte, daß man Südamerika wie ein Land der Jäger, Hirten und Bauern behandeln und mit Industrie- und High-Tech-Gütern beliefern kann. Im MERCOSUR-Raum besteht eine ausgewachsene Automobilindustrie. Und die Fahrzeuge dort fahren seit Jahrzehnten mit Bio-Kraftstoff. Und die Motorentechnik wurde vor Ort darauf ausgerichtet. Volkswagen und Ford haben eigene Motoren für den südamerikanischen Markt entwickelt. Ein (natürlich in Südamerika produzierter) VW fährt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit klimaneutral mit bspw. Bio-Ethanol. – Dies, während man im EU-Raum diese Kernindustrie in Grund und Boden zu regulieren versucht und Verantwortungsträger, deren naturwissenschaftliches Verständnis kaum die Grenzen des „Sachunterricht“ in der Volksschule zu überschreiten scheint, auf die reine E-Mobilität setzen.

Im MERCOSUR-Raum wird pragmatischer gedacht und manchmal schneller auf Fehler reagiert. Dies könnte die Situation herbeiführen, daß plötzlich der EU-Raum der Unterlegene in einem Abkommen ist, das von einer schwer nachvollziehbaren Einstellung europäischer Überlegenheit geprägt war.
Freihandel ist nicht automatisch schlecht. Im Gegenteil, wenn man mit Sach- und Fachkenntnis an das Erarbeiten von solchen Abkommen macht und sich auch in die Möglichkeiten des Vertragspartners hineindenkt. Dies ist augenscheinlich beim derzeit vorgelegten Vertragswerk – zumindest von EU-Seite nicht der Fall, weshalb man es derweil eher bleiben lassen sollte und nicht trotzig wieder und wieder vorlegen soll, bis die Mitgliedsstaaten endlich mitspielen.
Fotos:
Reisepass © wikimedia / Flx00 / cc by 4.0
Volkswagen SpaceCross © wikimedia / Matti Blume / cc by-sa 4.0