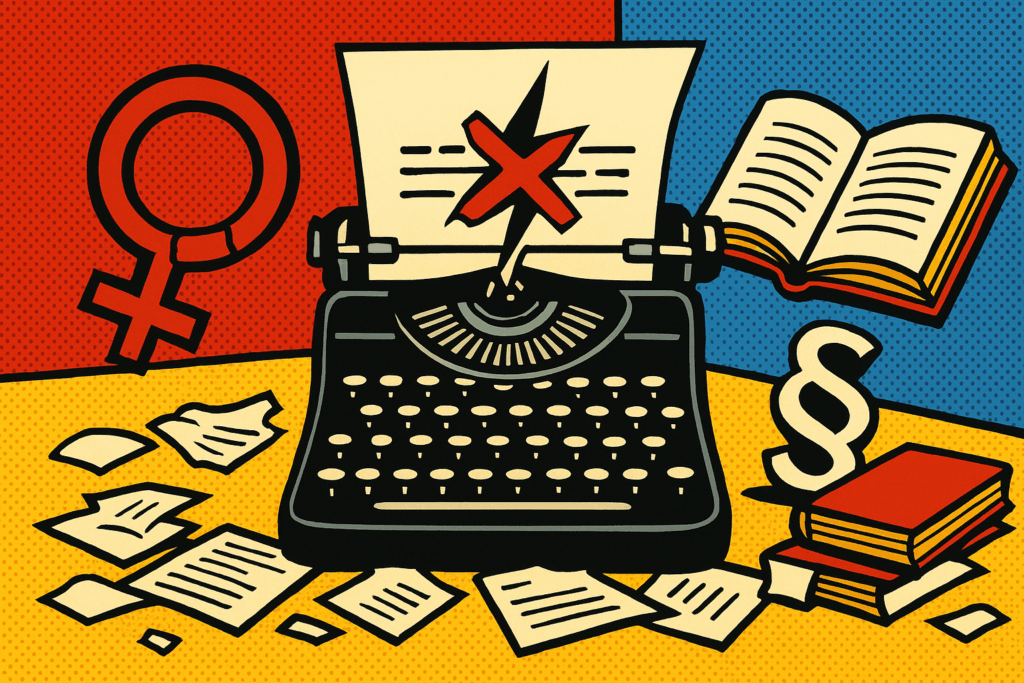
Es war ein Paukenschlag, der im ersten Moment fast zu banal klang, um ein politisches Erdbeben auszulösen: Niederösterreich, die Steiermark und nun auch das österreichische Parlament beschlossen, die sogenannte „Gender-Sprache“ aus ihren Amts- und Gesetzestexten zu verbannen. Keine Sternchen, keine Doppelpunkte, keine Binnen-Is mehr – nur noch die schnöde, alte, grammatikalisch korrekte deutsche Sprache.
Was folgte, war keine sachliche Debatte, sondern ein orchestriertes Aufheulen jener, die sich seit Jahrzehnten als moralische Deuter und Gralshüter der „fortschrittlichen Gesellschaft“ begreifen. Von „Rückschritt“ war die Rede, von „Kulturkampf“, ja gar vom Versuch, „das Rad der Zeit zurückzudrehen“.
Nun – wer so pathetisch jammert, verrät ungewollt, dass er etwas zu verlieren glaubt. Und tatsächlich: Die politische Linke verliert gerade die Deutungshoheit über die Sprache – jenes letzte Refugium, in dem sie sich noch unangefochten wähnte.
Der wahre Kulturkampf begann nicht gestern – sondern 1968
Wenn man die Empörung über die sprachliche Rückkehr zur Normalität verstehen will, muss man in die späten Sechzigerjahre zurückgehen – in jenes Jahr, das seither wie ein Heiligenbild in linken Wohnzimmern hängt: 1968.
Damals begann das, was man später den „Marsch durch die Institutionen“ nannte – ein Begriff, der ursprünglich als Strategie gegen Machtmissbrauch gedacht war, aber rasch zur Gebrauchsanweisung für eine neue, ideologisch aufgeladene Machtübernahme wurde.
Die „68er“, jene bunte Mischung aus Studenten, Revoluzzern, Traumtänzern und Theoretikern, wollten die Gesellschaft nicht reformieren, sondern neu erfinden. Ihr Ziel war kein Austausch der Eliten, sondern der Werte selbst. Statt der alten Ordnung sollte eine neue Moral treten – eine, die sich auf den ersten Blick modern, frei und human gab, in Wahrheit aber zutiefst autoritär war: Sie beanspruchte, nicht nur das Richtige zu wissen, sondern auch das Gute zu verkörpern.
Wer dagegenhielt, wurde nicht mehr als Gegner, sondern als „Feind“ betrachtet – nicht intellektuell, sondern moralisch minderbemittelt.
So begann der Kulturkampf. Leise, schleichend, mit dem freundlichen Lächeln des angeblichen Fortschritts.
Fünfzig Jahre „Marsch durch die Institutionen“ – ein Marsch in die Hegemonie
Fünf Jahrzehnte später hat man den langen Marsch erfolgreich abgeschlossen.
Universitäten, Kulturbetriebe, Medienhäuser, NGOs, Theater, Redaktionen, und ein nicht unbedeutender Teil der öffentlichen Verwaltung – sie alle sind durchzogen von jener moralisch aufgeladenen Linksliberalität, die sich selbst als objektive Vernunft verkauft.
Die, die den „Marsch“ antraten, sitzen heute in den Sesseln der Kulturreferate, den Redaktionsstuben, den Rundfunkräten und Kunstjurys. Ihre Kinder und Enkel lehren an Pädagogischen Hochschulen, schreiben über „toxische Männlichkeit“ und „koloniale Sprache“ und leben in der bequemen Gewissheit, dass sie das Gute nicht nur denken, sondern auch verwalten.
Diese Hegemonie ist der wahre Erfolg der 68er. Nicht die Barrikaden, nicht die Revolte, sondern die schleichende Institutionalisierung ihrer Weltanschauung – bis hinein in das Kleingedruckte der Sprache.
Die Sprache als Frontlinie
Sprache ist kein neutrales Werkzeug, sie ist Macht. Wer über sie verfügt, der definiert, was sagbar ist – und was nicht. Wer bestimmt, welche Worte als „richtig“ und welche als „verletzend“ gelten, der legt letztlich fest, wie gedacht werden darf.
Die Gender-Sprache ist daher kein bloßes Ausdrucksmittel, sondern ein Herrschaftsinstrument – ein sichtbares Symbol eines moralischen Systems, das seine Legitimität nicht mehr aus Vernunft oder Diskurs bezieht, sondern aus Gesinnung.
Wer sie ablehnt, gilt nicht einfach als anderer Meinung, sondern als verdächtig: reaktionär, rückständig, sexistisch, homophob, oder gleich „rechts“.
Und nun wagen es ein paar Landesregierungen und das Parlament, diese selbstverordnete Sprachregelung einfach wieder abzuschaffen. Welch Sakrileg!
Plötzlich steht die linke Kulturhegemonie nackt im Raum – ohne Sternchen, ohne Doppelpunkte, ohne Tarnung.
Empörung als Beruf und Weltanschauung
Der Aufschrei war dementsprechend groß. Die üblichen Verdächtigen eilten herbei – Journalist*innen, Aktivist_innen, Sprachwissenschaftler:innen mit missionarischem Eifer –, um das Abendland vor dem Untergang in der Grammatik zu retten.
Die Empörung ist mittlerweile zur letzten verbliebenen Energiequelle einer politischen Linken geworden, die längst den Boden unter den Füßen verloren hat.
Sie lebt davon, stets irgendwo eine Bedrohung zu wittern: das Klima, das Kapital, das Patriarchat, jetzt eben die Sprache. Wo kein Feind ist, wird einer konstruiert. Denn nur im permanenten Alarmzustand lässt sich die eigene moralische Überlegenheit aufrechterhalten.
Die linke Planwirtschaft der Moral
Dieser Kulturkampf hat nicht nur geistige, sondern sehr materielle Dimensionen.
Man hat in den letzten Jahrzehnten ein gigantisches, steuerfinanziertes Netzwerk errichtet, das von der öffentlichen Hand lebt und der öffentlichen Kontrolle entzogen ist – NGOs, Vereine, Kulturinitiativen, Förderstellen, die sich selbst als „kritische Zivilgesellschaft“ verstehen, in Wahrheit aber ein ökonomisches Biotop des Gesinnungskonsenses bilden.
Das Linzer Kunstmuseum LENTOS ist ein Paradebeispiel dafür, wie aus „Kulturförderung“ ein Versorgungssystem geworden ist.
Die Zahlen sprechen für sich – oder gegen sich, je nach Perspektive: Es wäre billiger, jedem Besucher ein Bahnticket nach Wien, ein Taxi zum Museumsquartier und die Eintrittskarte dort zu spendieren, als die Defizite des LENTOS weiter auszugleichen. Doch warum etwas ändern, das sich ideologisch so wohlig anfühlt?
In dieser Welt zählt nicht der künstlerische Wert, sondern die Gesinnung des Kurators. Nicht das Publikum, sondern die Haltung.
Die Kunst wird zum Feigenblatt einer politischen Agenda, die längst jeden Bezug zur Realität verloren hat.
NGO – Non Governmental? Von wegen!
Noch deutlicher wird dieses Muster im Bereich Migration und Asyl.
Zig Organisationen, die sich „non governmental“ nennen, leben faktisch ausschließlich von staatlichen Subventionen. Sie nennen sich unabhängig, arbeiten aber inhaltlich wie Außenstellen der Parteien, deren moralische Agenda sie teilen.
Ihr Selbstverständnis gleicht dem einer modernen Priesterschaft: Sie wissen, was „human“ ist, sie definieren das Gute, und sie verteilen Absolution – gegen Geld aus der Staatskasse.
Daß ihre Aktivitäten oftmals dem Mehrheitswillen widersprechen, scheint sie nicht im Geringsten zu stören. Schließlich steht über dem Wähler noch das höhere Recht der moralischen Erleuchtung.
Der Feind als Lebenselixier
Der eigentliche Motor des linken Kulturkampfs ist nicht die Liebe zur Gerechtigkeit, sondern die Notwendigkeit des Gegners.
Ohne ihn wäre man nämlich nur noch das, was man längst geworden ist: eine saturierte, verbeamtete, intellektuell müde Kaste von Meinungsdiktatoren.
Deshalb braucht man den Feind – den Rechten, den Reaktionär, den Konservativen, den Katholiken, den Maskulinisten, den Traditionsbewahrer.
Sie sind die Projektionsfläche, an der man sich moralisch noch aufrichten kann.
Deshalb wird jeder Widerspruch sofort zum Angriff erklärt. Deshalb genügt schon der Verzicht auf ein Gendersternchen, um den Untergang der Zivilisation heraufzubeschwören.
Cancel Culture – die digitale Guillotine
Wo einst argumentiert wurde, wird heute gelöscht.
Die Cancel Culture ist die perfideste Waffe im Arsenal des linken Kulturkampfs. Sie vernichtet nicht Meinungen, sondern Menschen – öffentlich, ritualisiert, mit moralischem Unterton.
Sie braucht keine Beweise, keine Fairness, keine Debatte. Es reicht die Anschuldigung, man habe etwas „Problematisches“ gesagt (oder nur gedacht).
Das Ergebnis ist eine Gesellschaft, die nicht mehr streitet, sondern meidet.
Man sagt nicht mehr, was man denkt – man denkt, was man sagen darf.
Der Versuch der Gegenwehr
Daß sich nun Widerstand regt – sprachlich, politisch, gesellschaftlich –, überrascht die linke Szene zutiefst.
Man hatte sich an die bequeme Vorstellung gewöhnt, das „Fortschrittliche“ gepachtet zu haben. Nun aber treten Menschen auf, die sich diese moralische Bevormundung nicht länger gefallen lassen.
Sie fordern nichts weiter, als den Respekt vor der Normalität – vor der Familie, der Tradition, der Heimat, vor dem Recht, die Dinge beim Namen zu nennen.
Für jene, die Jahrzehnte lang glaubten, die Kultur sei ihr Eigentum, muss das wie ein Aufstand der Barbaren wirken.
Studentenverbindungen als Lieblingsfeindbild
Nichts illustriert diese Dynamik besser als der Umgang mit konservativen Studentenverbindungen.
Kaum ein Medium widmet ihnen so viel Aufmerksamkeit wie Der Standard, der jüngst eine fünfteilige Podcast-Serie über die angebliche Macht „schlagender Verbindungen“ brachte – ein Lehrstück in Einseitigkeit.
Die Realität ist schlicht: Diese Verbindungen existieren noch, sie haben Nachwuchs, sie bilden Akademiker aus, die in der freien Wirtschaft erfolgreich sind. Und sie sind – welch Frevel! – nicht links.
Das allein genügt, um sie zum Feindbild zu machen. Der Haß auf sie ist ein Reflex, ein Erbe jener 68er, die sich damals an allem abarbeiteten, was nach Ordnung, Disziplin oder Tradition roch.
Das Ende der moralischen Monokultur
Vielleicht ist das, was wir heute erleben, keine Eskalation des Kulturkampfs, sondern sein Ende.
Denn die moralische Monokultur der Linken beginnt zu welken. Zu viele Menschen spüren, dass der moralische Zeigefinger nicht die Wahrheit ersetzt. Zu viele erkennen, dass das, was ihnen als Fortschritt verkauft wird, in Wahrheit eine Form von sozialer Kontrolle ist.
Man darf das als Emanzipation der Normalität verstehen – als friedliche Revolte gegen die Bevormundung.
Schlußgedanke: Kulturkampf als Selbstverteidigung
Ja, es gibt einen Kulturkampf. Aber nicht, weil die Rechte ihn begonnen hätte, sondern weil die Linke ihn seit über fünfzig Jahren führt.
Er tobt in Schulen und Redaktionen, in Theatern und Ministerien, in Sprachregelungen und Subventionsanträgen.
Daß nun endlich Gegenwehr kommt, ist kein Angriff, sondern Selbstverteidigung.
Der Kulturkampf endet an dem Tag, an dem niemand mehr glaubt, anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben, zu sprechen und zu denken haben.
Bis dahin gilt:
Wer sich weigert, sich moralisch umerziehen zu lassen, ist kein Reaktionär – er ist schlicht ein freier Mensch.
Wie konnte es soweit kommen?
Die Amerikaner begannen bei den Kriegsverlierern mit einer Gehirnwäsche/Umerziehung (reeducation) – die Umerzieher kamen aus Amerika: im Institut für Sozialforschung in Frankfurt begannen die Professoren Max Horkheimer, Theodor W. Adorno u.a. mit ihrer „Kritischen Theorie“, einer Variante des westlichen Marxismus, ihr Unwesen zu treiben und die Jugend zu verführen. Die „Frankfurter Schule“ war der Nährboden einer wohlstandsverwahrlosten Studentengeneration, die gegen die Elter revoltierten – gegen jene, die ihnen mit ihrer Arbeit ein sorgenfreies Studentenleben ermöglichten. Selbstverständlich wurden nur linientreue Anhänger dieser Richtung protegiert und so erfolgte eine sich selbst reproduzierende Professorenschar, speziell bei den Sozial- und Geisteswissenschaften, die immer skurrilere Lehrstühle innehatten und haben. So gab es 2023 laut Wissenschaftsrat in Deutschland 173 Professuren mit einer Voll- oder Teildominanz in der Geschlechterforschung – daher diese 72 skurrilen verschiedenen Geschlechter!
Hauptangriffspunkte des Frankfurter Kulturmarxismus sind die Frau, die Familie und die christliche Religion. Ziel ist der Totalitarismus. Das strategisch wichtigste Mittel der Verschleierung, um Derartigem den Anschein von Legalität und Natürlichkeit zu geben, ist die bis ins Mark manipulierte und manipulierende Sprache der Political Correctness. So wird Krieg zur „Friedensmission“, das Zusammenbomben von Gesellschaften zum Demokratisierungsauftrag und das ungeborene Kind zu einem „Zellklumpen“. Kurz: Verwahrlostes Denken.
https://philosophia-perennis.com/2016/12/13/frankfurter-schule-deutschland/
Die Gehirnwäsche ist den Amis ja bestens gelungen, jetzt sind die Umerzogenen schon soweit, selbst umzuerziehen. Sie programmieren die Jugend mit digitaler Sucht , linker Volksverblödungsideologie, bestens mit Steuergeld subventioniert, und die ANTIFA ist heute der 68er Straßenpöbel.
Rolf Kosiek: Die FRANKFURTER SCHULE und ihre zersetzenden Auswirkungen:
https://www.youtube.com/watch?v=AiEtQZyIu30