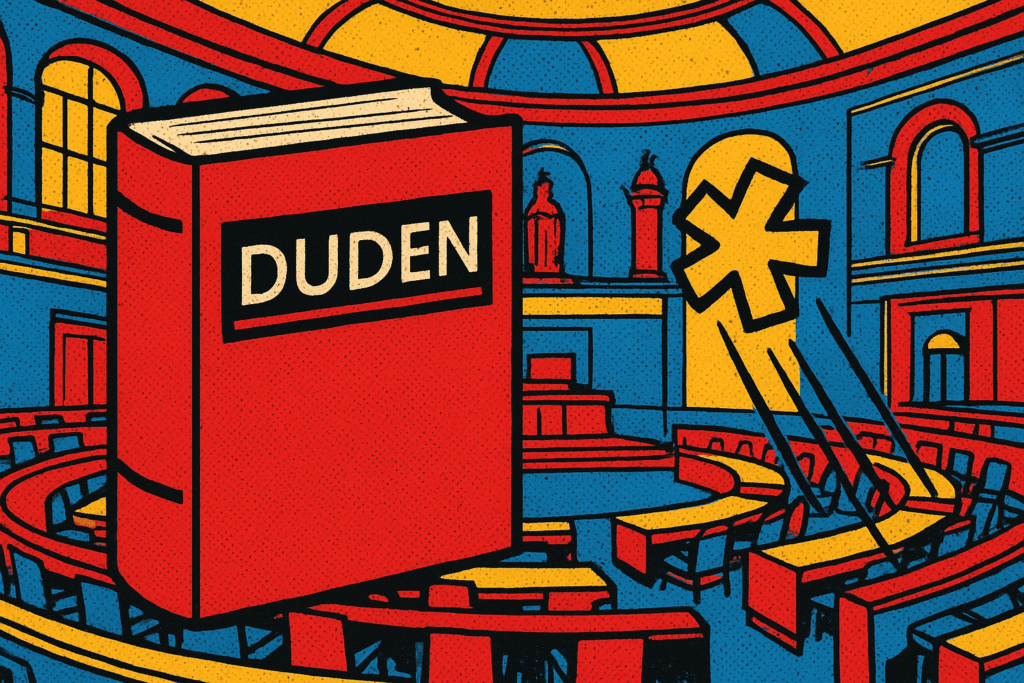
Zwischen Genus und Wahnsinn – Das Parlament spricht wieder Deutsch
Es gibt Momente, in denen ein Akt der Selbstverständlichkeit als Revolution missverstanden wird.
Einer dieser Momente ist jetzt.
Dr. Walter Rosenkranz, Präsident des österreichischen Nationalrats, hat verfügt, daß die Kommunikation der Parlamentsdirektion künftig wieder in der Sprache zu erfolgen hat, die in diesem Land Amtssprache ist: Deutsch – in seiner grammatikalisch, orthografisch und syntaktisch korrekten Form.
Also ohne Sternchen, ohne Doppelpunkte, ohne Unterstriche, ohne all die orthografischen Stolperdrähte, über die man schon beim Lesen fällt, bevor man den Satz überhaupt verstanden hat.
Man könnte meinen, das sei eine unspektakuläre Verwaltungsmaßnahme.
Doch weit gefehlt.
Was in Wahrheit nichts anderes ist als die Wiederherstellung der sprachlichen Normalität, wird von der politischen Linken, von Berufsaktivistinnen und -aktivisten, von „Gender-Kommissaren“ in Redaktionsstuben und Lehrsälen, als Anschlag auf die „Sichtbarkeit von Frauen“ gebrandmarkt.
Ein „Kulturkampf“, heißt es da – grotesk genug in einem Land, das einst Joseph Haydn, Karl Kraus und Ingeborg Bachmann hervorgebracht hat.
Das Verbot, das keines ist
Zunächst zur Klärung: Es gibt gar kein Verbot.
Es gibt lediglich eine Rückkehr zu geltenden Regeln.
Das ist, als würde man in einem Fußballspiel darauf hinweisen, daß Abseits auch weiterhin Abseits bleibt.
Rosenkranz hat nicht den Gebrauch einer „Gender-Sprache“ im privaten oder parteipolitischen Bereich untersagt. Er hat nur verfügt, daß in amtlichen Dokumenten und Veröffentlichungen des Parlaments jene Sprache zu verwenden ist, die für die Verwaltung Österreichs maßgeblich ist.
Und das ist nicht die Sprache der Ideologie, sondern die des Duden.
Wer das als „rückschrittlich“ bezeichnet, sollte sich fragen, ob Fortschritt wirklich darin besteht, die deutsche Grammatik nach tagespolitischem Geschmack umzuschreiben.
Und ob das Streichen eines Sternchens tatsächlich gleichbedeutend ist mit der Unterdrückung der Frau.
Die Grammatik – das letzte Bollwerk der Vernunft
Die Auseinandersetzung um das sogenannte Gendern ist längst keine linguistische, sondern eine ideologische Schlacht.
Man verwechselt das Genus, also das grammatikalische Geschlecht, mit dem Sexus, dem biologischen und im Regelfall auch gesellschaftlichen Geschlecht.
Das ist, als würde man behaupten, die Banane sei weiblich, weil sie im Deutschen feminin ist.
Der Mangel an sprachlichem Verständnis wird zur politischen Haltung erhoben, und wer darauf hinweist, wird als „reaktionär“ oder „frauenfeindlich“ etikettiert.
Dabei ist die Sprache keine willkürliche Spielwiese, sondern ein jahrhundertealtes System von Bedeutungen, Regeln und Entwicklungen.
Sie ist nicht da, um die eigene Moral zu illustrieren, sondern um Gedanken präzise zu transportieren.
Und das kann sie nur, wenn man sie nicht verunstaltet.
Die Tyrannei der Empfindlichkeit
Es ist bemerkenswert, mit welcher Inbrunst jene, die sonst jede Form staatlicher Regelung verdammen, nach Zensur schreien, sobald jemand auf den Gedanken kommt, das Gendern auf amtlicher Ebene zu beenden.
Plötzlich wird der freie Sprachgebrauch zum Grundrecht erhoben – freilich nur für jene, die sich an den ideologisch „richtigen“ Sprachformen beteiligen.
Wer lieber einfach Deutsch spricht, muß sich rechtfertigen, als wäre er im Besitz einer gefährlichen Idee.
In Klassenzimmern, Universitäten und Redaktionen hat sich ein Klima der Angst etabliert: Schüler und Studenten werden für korrekte Rechtschreibung schlechter benotet, weil sie das Binnen-I oder den Stern vergessen.
Manche Lehrende verwechseln ihre pädagogische Aufgabe mit der Missionierung.
Aus dem Hörsaal ist ein Tempel der Tugend geworden, in dem das falsche Pronomen als Sakrileg gilt.
Es ist diese Heuchelei, gegen die Rosenkranz vielleicht nur unbewußt, aber spürbar auftritt.
Er verteidigt nicht nur die Sprache, sondern die Freiheit, sie nicht ideologisch gefärbt verwenden zu müssen.
80 Prozent sagen Nein – und das soll niemand hören
Laut allen verfügbaren Umfragen lehnt eine überwältigende Mehrheit der Österreicher – rund 80 Prozent – das Gendern ab.
Nicht aus Bosheit, nicht aus Rückständigkeit, sondern weil sie es schlicht als unnötig, unpraktisch und unästhetisch empfinden.
Trotzdem wird diese Mehrheit in öffentlichen Debatten als „bildungsfern“ oder „reaktionär“ abgetan.
Das ist eine erstaunliche Form der Arroganz: Wer die Meinung der Mehrheit teilt, wird von einer Minderheit für dumm erklärt.
Demokratie lebt jedoch nicht davon, daß sich eine lautstarke Minderheit über die Mehrheit erhebt, sondern daß Regeln für alle gelten.
Und genau das tut Rosenkranz: Er stellt den Gleichheitsgrundsatz in der Sprache wieder her – nicht durch Zwang, sondern durch Entideologisierung.
Die Geschichte einer Entgleisung
Wie konnte es überhaupt so weit kommen?
Das Gendern begann einst als wohlmeinender, aber von Anfang an untauglicher Versuch, die Sprache sensibler zu machen.
Man wollte Frauen stärker sichtbar machen, wollte Gleichberechtigung auch grammatikalisch ausdrücken.
Ein ehrenwertes, wenn auch blauäugiges Anliegen, das zum Selbstzweck verkam.
Plötzlich war nicht mehr der Inhalt entscheidend, sondern die Form.
Nicht, WAS gesagt wurde, sondern WIE.
Aus einer Frage des Stils wurde ein Test der Gesinnung.
Und wer die falsche sprachliche Wendung wählte, galt als verdächtig.
Das führte zur paradoxen Situation, daß man Sätze produzierte, die sich lesen wie Kollisionen von Buchstaben und Ideologie:
„Die Lehrer*innen sind aufgefordert, ihre Schüler_innen über ihre Mitschüler:innen zu informieren.“
Ein Satz wie ein Stolperdraht, der schon durch seine Existenz beweist, daß hier kein Denken mehr möglich ist.
Ein Präsident mit Hausverstand
Rosenkranz hat erkannt, daß das Maß voll ist.
Seine Anordnung ist kein Kreuzzug, sondern ein Akt sprachlicher Hygiene.
Er stellt Ordnung her, wo die Unordnung zur Tugend erhoben wurde.
Natürlich empören sich die üblichen Verdächtigen:
Die SPÖ spricht von einem „Sprach-Kulturkampf“, die Grünen wittern ein „Rollback in die 50er Jahre“, selbsternannt „liberale Kommentatoren“ schreiben von einer „Machtdemonstration“.
Doch wer die Quellen liest, erkennt rasch: Hier wird niemand unterdrückt – es wird lediglich wieder Deutsch gesprochen.
Das ist keine Revolution, das ist gesunder Menschenverstand.
Und gerade deshalb ist es für manche so unerträglich.
Die Ironie des Fortschritts
Bemerkenswert ist, daß ausgerechnet jene, die ständig von „Vielfalt“ und „Inklusion“ sprechen, jede sprachliche Vielfalt außerhalb des Gender-Katechismus ablehnen.
Wer einfach korrekt Deutsch schreibt, gilt als suspekt.
Wer die Sprache verteidigt, verteidigt angeblich „Patriarchat“ und „alte Strukturen“.
Dabei ist die wahre Vielfalt die des Ausdrucks, der Stile, der Gedanken.
Nicht die des Interpunktionszeichens mitten im Wort.
Eine Gesellschaft, die glaubt, durch Sprachverrenkungen Gerechtigkeit zu schaffen, mißtraut letztlich der Vernunft ihrer Bürger.
Sie ersetzt Denken durch Zeichen.
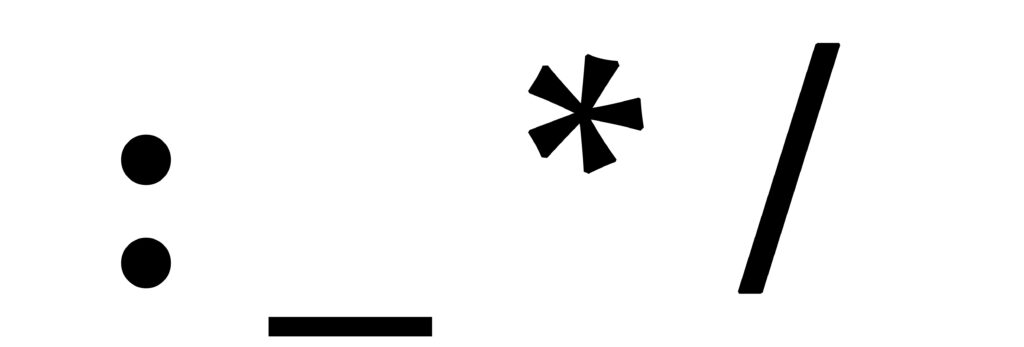
Der Duden – keine ideologische Waffe
Der Duden ist kein Parteiprogramm, sondern ein Werkzeug.
Er beschreibt die Sprache, er schreibt sie nicht vor.
Doch er ist das gemeinsame Fundament, auf dem Verständigung möglich ist.
Wenn jeder seine eigene Grammatik bastelt, wird Verständigung zur Glückssache.
Die Amtssprache ist die gemeinsame Währung der Kommunikation.
Man kann privat in Dialekten, Sprachen oder mit künstlerischer Freiheit schreiben – aber in amtlichen Texten gilt die Regel.
Das ist nicht „Zwang“, sondern Ordnung.
Ohne Ordnung ist Sprache nichts als Lärm.
Satire oder Realität?
Manchmal wirkt die Debatte wie eine Parodie auf sich selbst.
Einige Aktivisten sprechen allen Ernstes von „unsichtbar gemachten Menschen“, wenn man auf das Gendersternchen verzichtet.
Andere fordern, man müsse die deutsche Sprache „dekolonialisieren“ – als wäre der Dativ ein Relikt imperialer Unterdrückung.
Daß solche Wortakrobatik in den Parlamenten Europas diskutiert wird, während reale Probleme ungelöst bleiben, ist eine Farce.
Man kann Rosenkranz also auch als Sprachrealisten verstehen:
Er will das Parlament von einem Nebenschauplatz zurückholen zur Hauptsache – der Politik.
Sprache als Spiegel der Vernunft
Sprache prägt Denken, ja – aber sie darf das Denken nicht ersetzen.
Das Gendern, wie es heute betrieben wird, hat längst den Charakter einer Ersatzreligion angenommen.
Mit ihren Dogmen, Ritualen und natürlich auch Exkommunikationen.
Wer den Stern vergißt, sündigt.
Wer ihn in Frage stellt, wird verbannt.
Walter Rosenkranz’ Entscheidung ist der erste Schritt zur Entzauberung dieses Kults.
Er führt die Sprache zurück auf den Boden der Realität.
Nicht, weil er die Gleichberechtigung ablehnt, sondern weil er erkennt:
Gleichberechtigung braucht keine orthografische Maskerade.
Fazit: Ein Hoch auf die Normalität
In einer Zeit, in der alles Meinung ist, ist die Rückkehr zur Regel fast schon ein revolutionärer Akt. Aber eben nur fast.
Rosenkranz hat nichts anderes getan, als die Selbstverständlichkeit zu verteidigen – und genau deshalb tobt der Sturm.
Denn wer an die Stelle der Vernunft das Gefühl gesetzt hat, empfindet jedes Stück Ordnung als Angriff.
Doch vielleicht – nur vielleicht – ist dieser Schritt der Beginn einer sprachlichen Renaissance.
Einer Rückkehr zu Klarheit, zur Eindeutigkeit, zu Schönheit und Lesbarkeit.
Einer Erinnerung daran, daß die deutsche Sprache groß genug ist, um alle zu umfassen, ohne sich selbst zu verstümmeln.
Walter Rosenkranz hat die Tür geöffnet.
Er hat das Licht eingeschaltet in einem Raum, in dem man sich an das zwielichtige Flackern der Kerzen gewöhnt hatte.
Das ist kein Kulturkampf.
Das ist – schlicht und einfach – Kultur.
Warum hört oder liest man solch Analysen wohl nicht im ORF?
„Walter Rosenkranz’ Entscheidung ist der erste Schritt zur Entzauberung dieses Kults. Er führt die Sprache zurück auf den Boden der Realität. Nicht, weil er die Gleichberechtigung ablehnt, sondern weil er erkennt: Gleichberechtigung braucht keine orthografische Maskerade.“
Nachgerade wohltuend derlei Analysen auf der Gazette zu lesen!
Einfach ein genialer Satz!
„Wer lieber einfach Deutsch spricht, muß sich rechtfertigen, als wäre er im Besitz einer gefährlichen Idee.“
Heinz Conrads müsste heute mit seiner unvergesslichen Begrüßung Mut haben: „Servus die Madln, servas die Buam“ – weit sind wir gesunken, jetzt allerdings darf wieder Tacheles geredet werden, zumindest im Parlament – das sollte doch Vorbildwirkung haben!
Früher war alles einfacher, alles logisch, da begrüßte man sich noch mit Damen und Herren, auch Frau oder gar Fräulein war eine höfliche Anrede – aber heute? Der Kommunist Pierer begrüßte im Brucker Gemeinderat die ehemaligen Damen und Herren mit: „Sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben“ – also zurück zur Normalität und zwar sofort und überall!